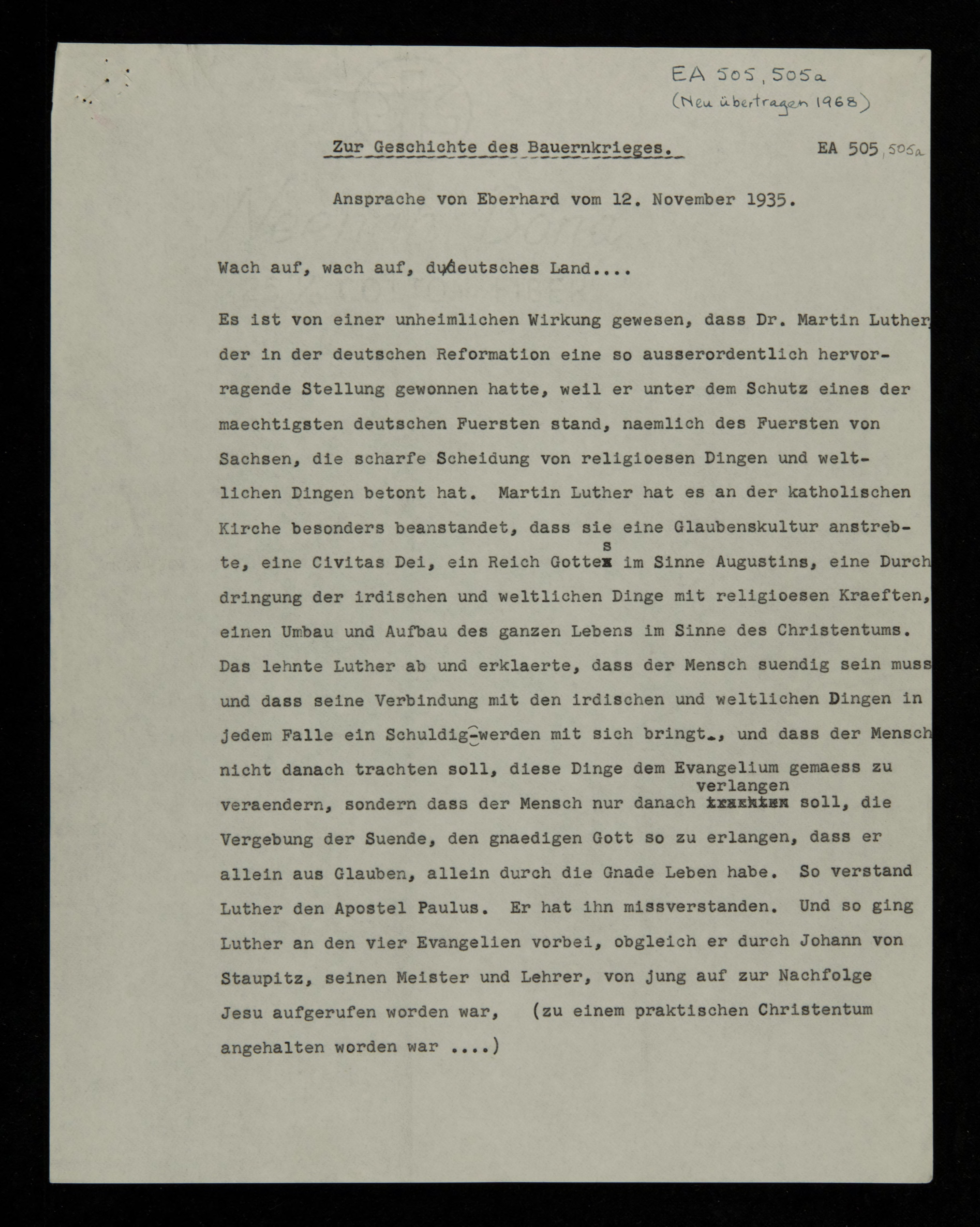This document is part of a series. Select the image(s) to download.
Transcribed Shorthand
Versammlungsprotokoll, 12. November 1935 (Meeting Transcript, November 12, 1935)
EA 505
| Additional Information | |
|---|---|
| Author | |
| Date | November 12, 1935 |
| Document Id | 20126154_13_S |
Meeting Transcript, November 12, 1935
[Arnold, Eberhard and Emmy papers - T.S.H.]
[Draft Translation by Bruderhof Historical Archive]
EA 505
Regarding the Peasants' War and Baptizer Movement
A talk given by E.A. Nov.11, 12 1935
Dr. Martin Luther won such an extremely prominent place in the Reformation in Germany because he stood under the protection of one of the strongest German princes, the Prince of Saxony.(K p349/50) He emphasized the sharp division of religious matters from secular ones, and this has had distressing consequences. Martin Luther especially objected to the Catholic Church for aspiring to a religious civilization, a Civitas Dei, a kingdom of God in Augustine's sense, a pervading of what is earthly and worldly with religious powers, a rebuilding and building up of the whole of life in accordance with Christianity.
Luther rejected this. He said man has to be sinful, and that his connections with earthly and secular things simply make him guilty; he should not seek to change these things to accord with the Gospel, but only long for the forgiveness of sin; so to reach the gracious God that he may live out of faith and have life simply through grace.(K353 4) That is how Luther understood the Apostle Paul.(K351f) He misunderstood him. As a result he passed by the four Gospels, although he had been challenged from his youth by Johann von Staupitz, his master and teacher, to discipleship of Christ.[K324 327,340] He had been urged to give form to the whole of life as Jesus wanted: urged to a practical Christian life arising from the deepest mysticism of faith and the inmost union of heart with God. [1a] Staupitz, who had a much closer relationship with the brotherly movement in Nürnberg than unfortunately came to expression in our book, separated from Luther. He did so, not only out of weakness, for he did not have such a combatant nature as Luther, but because, like Hans Sachs and others in brotherly groups, he was indignant and horrified that no revolution of practical life had come through Luther's Reformation. (K350f) (MEII 846 Hans Hut) (MEII 33 Hans Denk) On the contrary, the misuse spread more and more that people in the strength of grace alone, out of faith alone, went on boldly sinning.(K346) (Troctesch p 806)
We have to consider all this if we want to understand the terrific rage Luther felt against the Peasants' War and against the brothers called Baptizers.(K362) (MEIII 421) For here, in two different movements that broke out in the same year, 1525, he was confronted once more with the claim that the worldly and the Christian, the secular and the spiritual, should be brought into harmony. This exasperated Luther and reduced him to a truly Teutonic rage, so that no murder was bad enough to crush this repeated "mixture" with all passion.(Gerdtell p29f,111)
It seemed to him that each claim, which wanted to apply the spiritual life to earthly, social, economic and political situations as well, was fanaticism leading to … This, however, was just the decisive thing for the brothers, whom men called Baptizers, that they could count themselves as belonging neither to the Catholic Church nor to a new Protestant Church. Deep down in their beginning, the decisive thing for them was simply that they wanted to have what was innermost brought to agree with all that was outward. They wanted to unite the spiritual with the secular fully, as Christ intended. They wanted to place social, economic, and political questions in the light of Jesus Christ just as much as questions of the heart, questions of the soul, interests of one's disposition and vibrations of feeling. Everything, no matter what it may be, was to be placed in the light of Christ. The whole of life was to be subjected to the King, Christ!
In some groups of the brothers whom men call Baptizers, the Kingdom of God on earth came more into the foreground. In other groups the heavenly Kingdom of God, in its infinite eternity, and completely pure, unchanging, character appeared more strongly. In both cases, however, whether the movement followed the perspective of the future in time, or the perspective of infinity within space, in both cases the movement wanted the future and the infinite to break into the present, into this life on earth, and here, in the given circumstances and relationships of human beings, to bring about a life in accordance with the Kingdom of God.
Today it has been confirmed historically that the Baptizers who had close association with the Hutterian Brethren, and the original movement of the Baptizers in Basel and Zürich, out of which the Hutterian Brethren came, as well as the whole Hutterian movement itself, had no part whatsoever in the Peasants' Revolt and in the violent deeds of bloodshed done by the peasants. (See EA, Hist.of Baptizer Movement in Reformation times) For the nature and character of the brothers, whom one called Baptizers, in Basel and Zurich, Tirol and Moravia, was completely free from any thought of violence. For the life of purity and of love, in accord with the Kingdom of God, was for them a life of peace. It was discipleship of Jesus in being crucified and killed without ever being able to crucify or kill another. We do not want to speak of the north German movements around Münster and Holland, in whose tracks other influences came through Melchior Hofmann. (ME 11 778) We do not want to speak more of the fact that the pastor, Rottmann, and the passionate fighting leader of the Schwert Brüder (sword brothers), and whatever else they were called, were much more strongly influenced by Martin Luther in Münster and in connection with the riot there than by the brothers whom men call Baptizers. Just one thing must be stated: the movement of the brothers in Basel and Zürich, but also later in Tirol and Moravia, was not connected with Thomas Münzer's powerful prophetic leadership in the Peasants' War or his influence on souls.
Of course, there were contacts between Münzer and the brothers. Even before the outbreak of the Peasants' War Thomas Münzer had come near Switzerland and had corresponded with Conrad Grebel, Felix Manz, and the other friends who later came to baptism. They all thanked him for his prophetical, mystical writings and for the firmness of his stand against the Catholic Mass and other Catholic abuses. At the same time, from the first letter to the last one, they energetically confronted him with the exhortation of the Spirit of Christ to have nothing to do with anything connected with bloody revolt.
Thus we know that Thomas Münzer had been warned by brothers who had something to say. It is also true that Hans Hut, the apostle of our Franconian region and of the Rhön region, the co founder of community of goods in Nikolsburg, knew Thomas Münzer well; and sold the writings of Thomas Münzer and those of Martin Luther, peddling them in his rucksack. Furthermore he was personally present at the peasants' battle at Frankenhausen. However it is also certain that Hans Hut took no part at all in the Peasants' War. He took no weapon, nor did he in any way summon people to the Peasants' War. It is true that Hans Hut, many months before the outbreak of the Peasants' War, foretold the Peasants' Revolution in church buildings and in public places, and pointed out that a mighty judgment of God faced the German people. It is true that the same Hans Hut, in the prophetic interpretation of John's Revelation, declared that the Turks were a divine scourge through which the approaching Day of God and God's judgment would be hastened. All the more, however, is it a fact that Hans Hut neither had wanted to make a revolt with the peasants, nor to go to battle with the Turks against the German kingdom.
Further, it is important to realize that it was only after the Peasants' War that Hans Hut was baptized by Hans Denck and became a brother in the sense of a baptized brother. The connections with Conrad Grebel are a little more difficult, for he had once made a remark to Zwingli that almost resembled that of Balthasar Hubmaier. It was that he was convinced if once all brothers in the Service of the Word would become united to preach the Word of God, and the Gospel, and the discipleship of Christ purely, and accept only people who were possessed by the Spirit of God, by baptism into the Church, then the majority would soon be Christian; and then the Council could also come into the hands of the brothers.
It is also asserted that Conrad Grebel, when driven out of Zürich, had conspired with the peasants near Zurich, who were in terrific unrest and excitement. But it is not asserted that he urged the peasants on to revolt, only that he used the mood of the peasants for his proclamation of the Gospel.
Still more sharply did matters come to a head with Balthasar Hubmaier. Dr.Balthasar Hubmaier, who had been in Basel, as were also Conrad Grebel and Hans Denck, about the time of 1522, and had sought the new way in the groups there, had doubtless from Waldshut had contact with the enraged peasants.
During a search of his house writings were found. Some of those found in his library contained quite definite social demands connected with the Peasants' War, made by the peasantry of the frontier region between South Germany and Switzerland, and of the Black Forest. Many researchers now assume that Balthasar Hubmaier had a hand in drawing up the Twelve Articles (of the peasants). These articles are actually the preliminary to the Peasants' War of course a purely intellectual and very moderate preliminary.
There is not the faintest threat of violence in these Twelve Articles, but only an abundance of demands, all of which are made in the light of the word of God and of the gospel of Jesus Christ. But just for that reason these Twelve Articles greatly roused the indignation of the princes and theologians of the day, especially Martin Luther, because they brought political, economic and social matters together with intellectual and spiritual ones.
We shall read these Articles and we will see that it is quite possible that Balthasar Hubmaier had shared in an advisory capacity in drawing them up. It is clear that he could not have drawn them up alone, for he certainly did not have such an influence as an individual. On the contrary, the excited peasants will have brought all their demands, hopes, and wild expectations to him. And then, as a friend of the oppressed proletariat moved by Christ, he will have advised them, and perhaps will have also helped them, with the formulation of the Twelve Articles. If that was the case, we have to say that he was enabled to modify the demands of the peasants in a wonderful way, and to place them in the light of the Gospel.
We could give many examples showing that the Baptizer Movement and the Peasants' Movement were in very strong mutual correspondence. How could it have been otherwise? Both movements broke out in the same year, 1525. They were the same nation, the same moved hearts. The Baptizer Movement wanted discipleship of Christ applied to all spheres of social, economic, and political life, to the actuality of human existence; and the concern in the Peasants' Movement was that State and Society should have consideration and no longer treat the proletarians of that day, the peasants, in such a barbarous and unchristian way. It is inconceivable that these movements passed one another by. But one cannot make these movements identical. In order to make this clear we must look a little more closely at the Peasants' Movement.
I should like to remind you of some aspects of German agriculture in the early Middle Ages: the arrangement of the whole area of pasture and arable land was strongly communal in old Germanic and Celtic Germany. Every free member of the village or tribal community had a claim to the use of arable land, pasture, and woodland. The Allmende was the common property and the communal land of the small group or large village. The land was divided among the individual tribes, and the old rights of the common land were gradually changed to firm agricultural settlements and their regulations. Fields, pasture, meadow, and woods had already from the time of the Alemanni, about 720, been legally safeguarded in all bordering communities. They had firm economic laws of communal enterprise. The margrave (border count) had the task of protecting this tract of land, held in common, from attacks and raids from outside. The whole community had the use of this tract of land held in common; its garden belonged to all. The individual villages also had common property, not only of woods and pasture, but also of ploughed land. In the early Middle Ages the common ploughed land was cultivated in common. From the agricultural standpoint it was a system of extensive grass farming with agriculture and cleared common woodland.
The Allmende (Swedish: Allmennige) comprised all land, which had not yet become private property. Thus the village community comprised the Allmende of the little village. The mark community comprised the land of the whole tract held in common. In this way the village community gradually developed, especially in south Germany and in Switzerland, simply founded on common property and mutual working economy.
Alongside this, private property arose almost imperceptibly. This came about through the system of farming; sometimes grass, sometimes arable, changing to agriculture. Now the arable land was divided in accordance with the firm obligation to conform to the rules governing an open field system. Each could cultivate only what the community wanted. But, as everyone who belonged to the farm village always received a particular piece of the arable land to cultivate, property gradually crept in; whereas pasture land still remained common to all for a long, long time; and does in part still today.
The individual peasant usually received a "hide" of land. This "hide" averaged about 30 Morgen. These "hides" were firmly bound among themselves to conform in the alternation of crops, in the time of cultivating, and also in the time of harvesting. The paths through the pastures, the rights of way, the rights to pasture, to keep watch on the fields, woodland and water, were completely communal. As a result the fattening of pigs was a communal matter; the woods provided the most important mast, beechnuts and acorns from the forest floor. The pasturing of the cattle was also communal. They were driven to the common pasture land and herded communally. Private property, at first very gradually, arose here too. Clearing the land and tilling it were naturally necessary for founding daughter villages. The common tract of land was cleared. In this way, first common possessions came into being, but private property especially crept into this common possession as extensive landed property. It was the most dangerous opponent of the village community.
Extensive landed property, alas, was introduced just as much by the pious people as by the knights. The knights did not like working the land communally. They had a small amount of meadow land which they did not mow themselves. They did not like arable land, so they left that to the peasants. How then did they get a livelihood? They did it by ruling. The knight, or nobleman, did so by managing, by ruling in the literal meaning of the word. He was the ruler. To begin with he was protector and supreme legal authority and then he became lord over the life and limb of the others. The others were his serfs, their persons were his property. In this way not the land, but their lives, became his property. The land remained meantime in the hands of the Allmende, and only the people became property. This shows us the unfathomable devilishness of this development.
With the exception of a few regions in northern Germany farming lost its independence more and more. It is true that meadow land in which hay was made still continued, but in general the nobility and the church attained such power over the people, the serfs, that management from which the nobility and the church lived consisted of rents, of interest, of taxes, dues, and work by their serfs not, to begin with, in landed property. This called for economic capacities, such as the capacity to rule. Even the smallest landed estate had something of the character of a small state, for the count or baron had the authority to judge. He used this power for his own profit by continually introducing more taxes. The only thing he did which had an economic character was the hunting of animals. Hunting was a very significant part of the knight's economy. That is why the chase played such a leading part in knightly tradition. The knight, in growing stronger, together with the church, tried to maintain superiority over the peasants, especially through hunting. In this way the burden laid upon the peasants grew tremendously in the 13th, 14th and especially in the 15th century. The peasants became more and more burdened by the nobles and the clergy.
In spite of this, the peasantry had preserved itself right into the 14th century in a way that commands respect. But, from the second half of the 14th century on, and in the 15th century, the significance of the peasant became more and more reduced. This fact hangs together with the growth of towns. As long as the peasant had to do with the knights only, he was able to defend himself, for the peasant needed the knight. The knight led him in the numerous feuds and border skirmishes. It was on this that the power of the knight rested: he was the officer of the village. Because the knight was dependent on the following of the peasants, he had again and again to make a bearable arrangement with his peasants.
The towns were different. From 1400 to 1500 the towns, through their new culture and their pride as citizens, oppressed agricultural labor, and increased the authority of the craft guilds of the town. The towns had no understanding at all for the peasants, and they made then more and more their serfs. The councilors of the towns were, for the peasants, just as much lords as were the noble knights; and the peasants were just as much their serfs. The pride of the tradespeople of the towns and of the patrician families was so extreme that the peasant was almost regarded as cattle.
In this way the inner and emotional indignation of the peasants rose higher and higher in the 15th century. It offended them that the pride of the citizen equalled that of the knight, because the towns had grown out of simple farming conditions, so had been originally small country towns. Thus there grew increasingly a feeling of revolt against the towns, as well as against the nobles. Serfdom came to be felt more and more as degradation and slavery, and as a robbery of Christian freedom. Especially the fact that the knights and the towns wanted not only to tie the peasants, then living, in the bonds of serfdom, but also their future descendants, filled the peasants with continually growing hatred. At the same time it enraged the peasant that his right to the Allmende was going more and more to the knights, towns, and princes, so that just what was still left of holy common property was being stolen from them by the lords. This explains the strong appeal to immemorial usage, in the Twelve Articles. The peasant was convinced that woods, meadows, and water are Allmende, that is, woods, meadows and water belong to God and all people. Woods, meadows, and water can never be private property except when wood, meadows and water have been stolen by rough, bloody, violence, as they had often experienced.(s.a. Bloch "Thomas Münzer" p 60 "Sieh zu, die Grundsuppe des Wuchers...")
The peasants were likewise filled with indignation by the labor required of them; for serfdom required that they had to do work on the open field, carry messages, do the duty of huntsmen and other tasks for the lord without being repaid in any way. Hunting, however, became more and more mass killing: hunting with hounds. It outraged the peasants especially that it was possible to establish the right to hunt over the peasants' fields. That is why one speaks of the Jagtteufel("hunting devil"). Thus the peasants and the landowners confronted each other as hostile parties.
The tithe was also felt as a tremendous burden. The tithe was like a double or triple tax, and the most burdensome of all payments. The great tithe comprised one tenth of the hay harvest, one tenth of the agricultural products, and one tenth of the livestock. Not only was a tenth of the hay taken, but also a tenth of the livestock. The hay had already been taxed, and when a tenth of the livestock had also to be given up, the livestock were also taxed. The nobles, the church, and the town took that.
Its most burdensome form was the small tithe, which was especially in the hands of the church. It was a tithe of all that was grown in the garden and required especially fine, detailed work. This tithe lay almost exclusively in the hands of the clergy. This was a main root of the indignation of the peasants against the clergy: that they took their tax from the women's sweat. That displeased the peasants; nor could it possibly please them.
That was the situation in the 15th and 16th centuries. The monasteries, orders of knighthood, and parsonages required ever greater incomes. The territorial management of the later principalities had its own police and scribe. The peasants hated nothing so much as the armed policeman and the scribe with his quill pen. They were the most hated people at the farm; for the peasant felt himself unable to cope with them. He could not fight with the policemen, nor compete in writing with the scribe.
At the same time the Germanic consciousness grew more and more embittered that Roman law was gaining ground, that the right of inheritance and other drastic owners' rights were increasing, and the share of the people was decreasing more and more. The entire peasantry found itself proletarianized, degraded, robbed of human rights, and of the Christian likeness, the image of God.
The peasant was of no class. He became a country proletarian, and this reached a very terrible degree in poor mountainous regions. We must remember that at that time the Swiss were very successful against Charles the Bold (1433 77), and that the simple country folk Through the Franciscan monks, the wandering preachers of the Waldensians, and other movements, through religious associations, and brotherhoods of all kinds, this idea of brotherhood, of the freedom and equality of a communistic fellowship in Christ's sense spread in the villages, and found a larger and larger following during the 15th century, that is, before the Reformation.
At the end of the 12th century the eternal gospel was preached, the gospel that asserted that the disinherited and degraded will possess the earth; the gospel that asserted that the earth belongs to God alone, and so belongs to all who are poor and disinherited, and to all who are degraded.
This message of Joachim of Floris was spread by a large number of wandering brothers, especially the Waldensians. Everywhere divine right was spoken of, not of a human right in which one human being has a right against another. Now a divine right was spoken of in which God has right in opposition to men. This means that human beings come down from their wealth and lordship and self importance, and that they simply all become brothers. "The Reformation of the Emperor Sigismund" of 1438 had already had a strong effect in this direction. This reformation, in the course of the 15th century, spread more and more to the secular sphere. When Luther and Zwingli appeared(and the brothers came), and Karlstadt and Münzer, then the peasants arose and said, "Now the divine right will be revealed; now Christian freedom will be brought about and established."
This urge had previously given rise to the Bundschuh, of which we have already spoken, to the rising in Allgaen and around Kempten in 1492, and also to the Peasants' Revolt of 1476; what the peasants in the diocese of Speyer had sought in 1502, what the Poor Konrad had begun in Württemberg, what had roused the peasants in the region of Bern and Zurich, now in 1525 broke out more strongly than ever before; but was also more violently and brutally suppressed than ever before.
The Reformers and especially the so called Baptizers, who really called themselves Brothers, spoke of the renewal of church and community, and declared that the church had to return to her first purity and love. Luther wrote 1. to the princes, 2.of the Babylonian Captivity of the Catholic Church and 3. for the freedom of the gospel. These three writings struck like lightning into the peasantry. Now they hoped political leaders were there at last, who would break the power of the nobility and the church. So the peasants expected from men like Luther and Zwingli the divine help through which injustice was to be overthrown and God's justice brought in. This, founded on the gospel, is what led to the program of revolution that had to call forth Luther's inordinate indignation, because it mixed the spiritual and the secular. The rising of the nobles had failed, as we know from the story of Sickingen and Ulrich von Hutten. Now the peasants wanted to rise. Who knows what might have happened if the nobles and peasants had united!
Now the social demands were put together with the spiritual demands of the peasants. What had not been granted to an Ulrich von Hutten was granted to the peasants. They spoke of redemption through Christ, of freedom in Christ, of the unlawfulness of the serfdom and slavery of the peasants. They rejected serfdom, repudiated the tithe, and demanded the restoration of the right to the Allmende, to the communal cultivation of the village's land.
Thus demands were put forward which were economic, social, and religious at one and the same time, and which actually had a political aim: the founding of a completely new social organization, with a completely new, and yet primeval, order including matters of property. All these considerations were connected in the deepest way with the original Christian movement and with the Reformation, yet without having arisen through any definite representatives of the Reformation.
Strong fermentation began in the southern Black Forest in 1524. In 1525 the demands were formulated in the region of Kempten, and the Swabian peasants presented their Twelve Articles. Faber says that strange peasants' articles were found in Balthasar Hubmaier's house when it was being searched, from which it follows that the peasants of Stühling and those in Klettgau were the first to rise up against the state. What the twelve Articles demand, which is far more important for us than the bloody course of events of the war itself, was as follows:
The first Article demands the freedom of the community to choose its pastor. The pastor should preach only the holy gospel, plain and simple, and so proclaim the true faith.
The second Article concerns the abolition of all unjust payments, especially that of the small tithe.
The third Article demands the abolition of serfdom, and says the following: "Seeing that Christ redeemed all human beings, the cowherd as well as the highest ruler, none excepted, with the shedding of his precious blood; no human being can be the serf or slave of another.
The fifth Article demands the necessary wood for burning and building, always only with the knowledge of the whole community, never according to the will of the lord.
The sixth and seventh Articles oppose the duties demanded of slaves; the forced, or statute, labor and taxes.
The eighth Article is also against exorbitant taxes and interest.
The ninth Article is against arbitrary punishment by the lord, and demands a verdict in accordance with written law.
The tenth Article demands that the communal property of the Allmende be given back to the village, for the lords have illegally taken the meadows, fields, and woods from the community, for these belong, as does water, to God and to all.
The eleventh Article opposes the so called heriot. When the head of the house died, the knight or monks could come and choose the best horse or the best cow he had had. That was robbing widows and orphans.
The twelfth Article declares; "If one or more of these Articles should be contrary to the word of God (if it is proved to us not to be in accordance with the word of God), we would give it up as soon as it is explained to us on the basis of Scripture. And if some of the Articles were granted us immediately and then found to be wrong, they ought to be abolished and be no more valid."
That indicates that brotherly influence was helping here. One cannot well imagine that the excited peasants could devise that out of their peasant heads without the Spirit of the Church; but one can, indeed, if the peasants have been gripped by the Spirit of the Waldensians or of the brotherly movement.
I believe that the Peasants' Movement is to be seen in connection with the brotherly movement, as very often in powerful times different extremes touch one another. One must not blame the brotherly movement on that account for the bloody revolt. On the contrary, in such agitated times everything is moved and vibrates together. Everything that is living must come into a living relationship with the true Christ movement. So we see that the peasants were not seeking help through brutal violence and crazy demands, but were seeking justice and understanding. Only when their wishes were not responded to did they take the sword.
Münzer had met the peasants and become their apocalyptic prophet. Out of a deep mysticism he set them on fire in a fanatical way to fight, in order that the Kingdom of God be established at last. This so enraged Martin Luther, after he had almost sided with the Twelve Articles, that he now regretted writing "Ermahnung zum Frieden auf die 12 Artikel der Bauernschaft("An admonition to Peace: a Reply to the Twelve Articles of the Peasants in Swabia") and wrote:"Wider die räuberischen und mÿrderischen Rotten der Bauern" (Against the Robbing and Murdering Hordes of Peasants"), about which we would rather keep silent(because it called for merciless killing and destruction). And the peasants were really completely beaten in 1525 near Frankenhausen, near Mühlhausen in Pfeddersheim. The rising in the Odenwald, the rising in Franconia, the rising in Saxony, the rising in the Black Forest, were beaten at once by all the princes, the nobles, and the towns, which had sent their strong armies against them. Suppression was carried out in the most brutal way. Thousands of peasants, after they had been defeated, were slaughtered as prisoners of the so called Christian ruling authority.
Now, if we continue to ask how far Balthasar Hubmaier was connected with the original challenge of the Twelve Articles, there are, to be sure, several points of contact in his life that suggest his taking part. He was active in the Black Forest, in Switzerland, and in Moravia. His guiding principle was "Truth cannot die. It will rise again and triumph and reign. Truth can be imprisoned, flogged, crucified, and laid in the grave, but it will always rise victorious and triumphant."
Balthasar Hubmaier was born in Friedberg, near Augsburg. He was small in stature, had a swarthy complexion, was full of intellectual vigor, and very lively in speech. He was highly praised by his teachers when he was a student in Freiburg in Breisgau in 1503. In 1510 he was ordained a priest. In Ingolstadt he received a licentiate and degree of Doctor of Divinity. In 1515 he became deputy Rector of the University and later preacher and pastor of the Domkirche in Regensburg. Already at that time he was concerned with economic questions, especially with the Jewish question, in which he made a very sharp attack on usury, so that he even had the strongest part in expelling the Jews. In Spring 1521 he became pastor in Waldshut, close to the passage of the Rhine near Switzerland. In summer 1522 an inner change began in him. It was in Basel in the group of friends there. He studied Luther's writings, the gospel, and Paul's letters. For a short time he went back to Regensburg, then returned to Waldshut. He took his stand more on the side of the Swiss than Luther did. In 1523 he conferred with Zwingli about baptism. "Zwingli said I was right, that infants should not be baptized before they had been instructed in the faith". He began his innovations in Waldshut itself. On October 28, 1523, he took part in the religious disputations of the citizens of Zurich in the town hall. In Zurich at that time he spoke sharply against the Mass and image worship, and declared that the Bible alone must decide such questions. The Mass is not a sacrifice, the Lord's Supper is a proclamation of the covenant of Christ, of his bitter suffering and sacrificing of himself. "As I cannot believe for another, for each must have faith for himself, neither can I say a Mass for him."
Already in 1523 he had the greatest following as a preacher. He had broken completely with the old church. At the same time he was in the strongest opposition to the Austrian government. He held his eighteen last speeches concerning the whole Christian life. From these we see he thought like Zwingli, Grebel, Manz, and Blaurock. The townsfolk came more and more to his side. He held divine service in Waldshut in German. All images were removed from the churches. Times of fasting were abolished. He married Elisabeth Hügeline, the daughter of a citizen from Reichenau, who willingly and courageously shared his lot, including his death.
All the government's attempts to maintain the old order failed, so it took to force, wanting to regain the town. In 1524 Hubmaier escaped their violence and went to Schaffhausen. Very soon he received warnings that they wanted to arrest him. He wanted to stay in Schaffhausen, and the town refused the demands of the Austrian government to give him up. In three pamphlets he declared himself ready to defend all that he had taught in the last two years. In order to defend himself from the charge of heresy, he published the pamphlet "Von Ketzern und ihren Verbrennen".("On Heretics and their Burning") He returned to Waldshut, which was in open opposition to Austria. Now it is interesting that Balthasar Hubmaier, in a somewhat similar way to Zwingli, became the soul of the political opposition to Austria. Balthasar Hubmaier still held firmly to Zwingli's direction. Grebel, Manz, Blaurock, and Wilhelm Reublin had already stood up against Zwingli, and declared that infant baptism was no baptism, that one must first come to have faith and then be baptized in accordance with Christian order and appointment.
On Jan 17,1525 the well known religious disputation took place in Zurich. Hubmaier dropped infant baptism.(Some Zurich Baptizers visited Hubmaier in Waldshut) On Feb.2,1525 his "Öffentliche Erbietung an alle christgläubige Menschen", ("Public explanation to all Men who believe in Christ") was published. He wanted to show that infant baptism has no basis in Scripture. He wanted to do this in clear, unambiguous, German writings. Almost all the townspeople were on Hubmaier's side: but the Swiss Reformers were offended and became Hubmaier's opponents. He held the Mass in German. Later he abolished it, and had all altars removed from the churches. He celebrated the Lord's Supper at simple tables, and finally was baptized on Easter Sunday 1525 by Wilhelm Reutlin.
Zwingli had in the meantime written the pamphlet "Von der Taufe, der Wiedertaufe, und Kindertaufe".("Concerning Baptism, Re Baptism and Infant Baptism") Hubmaier replied with "Vom Christlichen Tauf der Gläubigen".("Christian Baptism of Believers") The Zurich Council appointed a second disputation. Conrad Grebel, Felix Manz, and Georg Blaurock were imprisoned. (Six months later they escaped). Re Baptism was forbidden. Infant Baptism was commanded by the state. Hubmaier's pamphlet is dated November 30 but was only printed a year later in Nikolsburg. From that time on, further articles by Hubmaier appeared in print in Nikolsburg; for there he continued to carry out his ideals and his writing, as he could not succeed in doing in Waldshut.
Hand in hand with this activity, he continued his political opposition. The Peasants' Movement doubtless found strong, and perhaps already, leading support from Hubmaier. Some even regard Balthasar Hubmaier as one of the beginners of the whole Peasants' War. Later he published a pamphlet,"Eine kurze Entschuldigung" ("A Short Apology"), in which he says: "In making me out to be one who incites people to revolt, they are doing to me what they did to Christ. He also had to be a revolutionary. I testify before God and man that I have written and preached that one should be obedient to the government, for it is from God. It is true, however, that they wanted to turn us aside from the word of God with violence, against all right. That was our only complaint". The citizens of Waldshut also wanted to be obedient to Austria, as came to expression in their "offer": "If a stone ten Klafter (c.60 feet) under the earth were not good Austrian, we would want to scratch it out with our nails".
Hubmaier was no originator of the Peasants' War, but beyond a doubt in Waldshut he stood in close association with the peasants. Doubtless he supported them inwardly and also received help from them. He advised the people of Waldshut and wrote letters for them. He expanded and expounded the Peasants' Articles and told people that they should accept them as Christian and reasonable. The concern in Waldshut was for freedom of the gospel's doctrine. If this were granted to them and to the peasants, they were ready to fulfill all duties toward the government. The peasants and the people of Waldshut fought for the gospel. The government sought to beat both together: the peasants as well as the radical Protestant citizens of Waldshut. The peasants were defeated near Griessen, and then Waldshut was taken. Hubmaier managed with difficulty to save himself on December 5, 1525. We know that he fled on foot with his clothing torn to Zurich, and arrived in Nikolsburg in July,1526.
The Twelve Articles:...
The Baptizer brothers did not at all want a bloody revolution....These movements are completely related, the movement of the peasants and proletarians and the movement of the gospel of justice. The latter recognized that the communal movement of the Holy Spirit of the Church of Jesus Christ can never go the way of blood and violence that the Peasants' War took. So the Hutterian brotherhood was founded in order that all the just demands of the peasantry and proletariat be fulfilled in practice, without violence. We see that the Hutterian movement is the fulfillment of both the deepest longings of both the peasants and the proletarians, and the fulfillment of the demands of all who longed for the true gospel, for the peace and justice of the Kingdom of God.
When it is asserted of Conrad Grebel that he conspired with those peasants in the region of Zurich who had become restless, I should like to draw the following conclusion: There were peasant disturbances near Zurich and Bern in 1513. At that time a bloody revolt was on the point of breaking out. From 1522 to 1525 there were also very strong disturbances by peasants round about Zurich and Bern but no bloody rising. At the same time the movement which led the brotherly group to baptism in 1525 arose in Zurich and Basel, and later also in Bern.
In summer 1525 the Peasants' War broke out; but not in the vicinity of Basel, Zurich, and Bern. It is said that it was due to Zwingli's cleverness that the Peasants' War did not break out near Zurich: meeting the peasants' wishes, he had abolished serfdom. I believe, on the contrary, that the agitation of the whole peasantry was for the kingdom of God and his justice and righteousness. The peasants could not any longer endure the unbearable injustice crushing them. Now from one side, the Black Forest, came the call to bloody revolt. From the other side, through Georg Blaurock, came the call of the gospel, with the hope of a church life in community and in equality of birth. There they needed no bloody revolt. I am sure that the most excited and aroused elements were won by the words of the brothers in Zurich, so that the bloody revolt did not break out in the vicinity.
This movement of baptism is something wonderful, something infinitely wonderful. I hope you will understand that we are not doing this in order to flee from the twentieth century into the sixteenth century, but doing it for the sake of the twentieth century. Now it is time that the social, economic, and political situation is tackled once more by discipleship of Christ as community of the Kingdom of God! The Day of the Lord has come, and the kingdom of freedom and brotherliness is coming, and we are permitted to bring it near all people through the example of our common life! It is worth dying for that, if we give all our love to the oppressed proletarians; even though we do not hear their cry, we hear their silent cry. For them we must set up a life of brotherliness, of justice, and of freedom and unity in the midst of a cruel, tyrannical, and unjust age. Now the Church Community must stand together as never before, and with the most holy enthusiasm go towards the kingdom of God and to all people who are in needy circumstances and belong to the oppressed class. I ask all, without exception, to do this!
Brothers! Heed the Word!..
Books used:
The Peasants' War: Menn. Lex. A F pages 137 139
R.G.G.1 (A D) " 806 809
The Twelve Articles: Gerdtell,"Die Revolutionierung der Kirchen (s.Sachverzeiuchnis "Zwölf Artikel...")
Balthasar Hubmaier: Menn. Enc.D H p.846 (for MS p.4)
Reformation of Emperor Sigismund: R.G.G. (M R) Reiser, Friedrich p.1851,(for MS p 17)
Versammlungsprotokoll, 12. November 1935
[Arnold, Eberhard and Emmy papers - T.S.H.]
EA 505
Zur Geschichte des Bauernkrieges
Ansprache von Eberhard am 12. November 1935
Wach auf, wach auf, du deutsches Land …
Es ist von einer unheimlichen Wirkung gewesen, dass Dr. Martin Luther, der in der deutschen Reformation eine so außerordentlich hervorragende Stellung gewonnen hatte, weil er unter dem Schutz eines der mächtigsten deutschen Fürsten stand, nämlich des Fürsten von Sachsen, die scharfe Scheidung von religiösen Dingen und weltlichen Dingen betont hat. Martin Luther hat es an der katholischen Kirche besonders beanstandet, dass sie eine Glaubenskultur anstrebte, eine Civitas Dei, ein Reich Gottes im Sinne Augustins, eine Durchdringung der irdischen und weltlichen Dinge mit religiösen Kräften, einen Umbau und Aufbau des ganzen Lebens im Sinne des Christentums. Das lehnte Luther ab und erklärte, dass der Mensch sündig sein muss und dass seine Verbindung mit irdischen und weltlichen Dingen in jedem Falle ein schuldig Werden mit sich bringt, und dass der Mensch nicht danach trachten soll, diese Dinge dem Evangelium gemäß zu verändern, sondern dass der Mensch nur danach verlangen soll, die Vergebung der Sünde, den gnädigen Gott so zu erlangen, dass er allein aus Glauben, allein durch die Gnade Leben habe. So verstand Luther den Apostel Paulus. Es hat ihn missverstanden. Und so ging Luther an den vier Evangelien vorbei, obgleich er durch Johann von Staupitz, seinen Meister und Lehrer, von jung auf zur Nachfolge Jesu aufgerufen worden war, (zu einem praktischen Christentum angehalten worden war …)
- - -
… zu einem praktischen Christentum angehalten worden war, welches aus der tiefsten Mystik des Glauben, aus der innersten Gottesverbindung des Herzens das ganze Leben im Sinne Jesu gestalten sollte. Dass Staupitz, der mit der Nürnberger brüderischen Bewegung in einer viel engeren Verbindung stand, als es leider in unserem Buche zum Ausdruck kam, sich von Luther trennte, hatte dies nicht nur aus Schwäche getan, weil er keine so kämpferische Natur wie Luther gewesen war, sondern auch deshalb, weil er, ebenso wie Hans Sachs und die anderen brüderischen Kreise, empört und entsetzt darüber war, dass durch Luthers Reformation keine Umwälzung des praktischen Lebens zustande gekommen war, sondern im Gegenteil sich mehr und mehr der Missbrauch ausbreitete, dass die Menschen auf Gnade allein, aus Glauben allein tapfer weiter sündigten.
Das alles muss wohl bedacht werden, wenn man die ungeheure Wut Luthers gegen den Bauernkrieg und gegen die Brüder, die man die Täufer nennt, kennen lernt (verstehen will). Denn hier trat ihm in zwei verschiedenen Bewegungen, die im selben Jahre ausgebrochen sind (1525), wiederum die Forderung entgegen, dass das Weltliche und das Christliche, das Zeitliche und das Geistliche in Übereinstimmung miteinander gebracht werden soll. Das aber entrüstete Luther und versetzte ihn in einen wahren teutonischen Zorn, sodass ihm kein Mord schlimm genug war, um diese abermalige „Vermischung“ aufs
- - -
leidenschaftlichste niederzuschlagen. Denn ihm erschien jede Forderung, die das geistliche Leben auch auf irdische, soziale, wirtschaftliche und politische Verhältnisse anwenden wollte, als katholisierende Schwärmerei. Das aber war gerade das Entscheidende für die Brüder, die man die Täufer nennt, dass sie sich nicht zur katholischen Kirche, aber ebenso wenig zu einer neuen evangelischen Kirche rechnen konnten. Das war gerade das Entscheidende in ihrem inneren Anfang, dass sie das Innerste mit dem Äußersten in Übereinstimmung bringen wollten, dass sie das Geistliche mit dem Zeitlichen völlig im Sinne Christi vereinigen wollten, dass sie soziale, wirtschaftliche und politische Fragen ebenso unter das Licht Jesu Christi stellen wollten wie Herzensfragen, Seelenfragen, Gemütsbelange und schwingende Gefühle. Alles, was es auch sei, sollte unter das Licht Christi gestellt werden, das ganze, das gesamte Leben sollte dem König Christus unterworfen werden!
In einigen Kreisen der Brüder, die man die Täufer nennt, trat mehr das Reich Gottes auf Erden in den Vordergrund. In anderen Kreisen trat mehr das himmlische Reich Gottes in seiner unendlichen Ewigkeit und in seinem völlig reinen, unveränderlichen Charakter in Erscheinung. In beiden Fällen aber, ob die Bewegung als in der Zeit den Fluchtpunkt der Zukunft verfolgte, oder ob sie als im Raum den Fluchtpunkt der Unendlichkeit verfolgte, in beiden Fällen wollte die Bewegung, dass das Zukünftige und das Unendliche in die Gegenwart hereinbrechen sollte, in das Diesseits kommen sollte und hier unter den gegebenen Umständen und Verhält-
- - -
nissen der Menschen ein Leben zustande bringen sollte, das dem Reich Gottes entspricht.
Es steht heute geschichtlich fest, dass die Täufer, die mit den hutterischen Brüdern in Gemeinschaft gestanden haben, und die Urbewegung der Täufer in Basel und Zürich, von welcher die hutterischen Brüder ausgegangen sind, wie auch die ganze hutterische Bewegung selbst, in keiner Weise am Bauernaufruhr und an den blutigen Gewalttaten der Bauern Anteil gehabt haben. Denn das Wesen der Brüder, die man die Täufer nennt in diesem Sinne, in Basel und Zürich, Tirol und Mähren, war ganz frei von jedem gewalttätigen Gedanken. Denn die Reinheit des Lebens und die Liebe des Lebens im Sinne des Reiches Gottes war für sie ein Leben des Friedens, war Nachfolge Jesu im gekreuzigt und getötet Werden, ohne jemals einen anderen kreuzigen oder töten zu können. Nicht sprechen wollen wir davon, dass in den norddeutschen Bewegungen um Münster und Holland herum, in den Wegspuren(?), in welchen unter Melchior Hofmann andere Einflüsse eingebrochen sind … Nicht sprechen wollen wir weiter davon, dass der Pfarrer Rottmann und die leidenschaftlichen Kampfesführer der „Schwert-Brüder“ (und wie sie alle hießen) in Münster und im Zusammenhang mit dem münsterischen Aufruhr viel stärker von Martin Luther beeinflusst waren als von den Brüdern, die man die Täufer nennt. Eines muss nur festgestellt werden, dass die Bewegung der Brüder in Basel und Zürich, aber auch später in Tirol und Mähren, mit Thomas Münzers gewaltig(er) prophetischer Führung im (am) Bauernkriege oder Seelsorge (Beteiligung?) nicht verbunden war. Berührungen zwischen
- - -
Münzer und den Brüdern haben freilich stattgefunden. Noch bevor der Bauernkrieg ausgebrochen ist, kam Thomas Münzer in die Nähe der Schweiz und hat Briefe gewechselt mit Konrad Grebel, Felix Manz und den anderen Freunden, die nachher zur Taufe geschritten sind, und sie alle haben ihm gedankt für seine prophetischen, mystischen Schriften und für die (seine) Entschiedenheit, mit der er gegen die katholische Messe und gegen andere katholische Missbräuche aufgetreten war. Zugleich aber haben sie ihm vom ersten bis zum letzten Brief auf das energischste die Anrede (Einrede) des Geistes Christi vor Augen gestellt, dass er sich keinesfalls mit Dingen abgeben müsse, die irgendetwas mit blutigem Aufruhr zu tun hätten.
Wir wissen also, das Thomas Münzer gewarnt war von Brüdern, die ihm etwas zu sagen hatten. Richtig ist es auch, dass Hans Hut, der Apostel unserer fränkischen Landschaft und der Rhönlandschaft, der Mitbegründer der Gütergemeinschaft in Nikolsburg, Thomas Münzer gut gekannt hat und Schriften Thomas Münzers in seinem Rucksack (trug und) beim Bücherverkauf neben Schriften Martin Luthers angeboten hat, und dass er ferner bei der Bauernschlacht von Frankenhausen persönlich anwesend war. Aber sicher ist auch dies, dass Hans Hut nicht im geringsten am Bauernkrieg teilgenommen hat, dass er keine Waffe genommen hat oder sonst wie Menschen zum Bauernkrieg aufgefordert hat. Richtig ist, dass Hans Hut schon viele Monate vor dem Ausbruch des Bauernkrieges in Kirchengebäuden und auf öffentlichen Plätzen die Bauernrevolution vorausgesagt hat und darauf hingewiesen hat, dass hier dem deutschen Volke ein gewaltiges Gericht Gottes bevorstünde. Richtig ist, dass derselbe Hans Hut in der prophetischen Auslegung der Offenbarung Johannes darauf hin-
- - -
gewiesen hat, dass die Türken eine Gottesgeißel seien, durch die das Gericht Gottes und der herannahende Tag Gottes beschleunigt werden sollte. Fest steht aber umso mehr, dass Hans Hut weder gewillt war, mit den Bauern einen Aufruhr zu machen, noch mit den Türken gegen das deutsche Reich zu Felde zu ziehen.
Ferner ist es wichtig zu sagen (sehen), dass Hans Hut erst nach dem Bauernkrieg mit Hans Denck zur Taufe geschritten ist und ein Bruder im Sinne der getauften Brüder geworden ist.
Schwieriger stehen die Verhältnisse schon ein wenig bei Konrad Grebel; denn er hat einmal zu Zwingli die Bemerkung gemacht, die beinahe Balthasar Hubmaier ähnelt: Er sei überzeugt, wenn erst einmal alle im Dienst am Wort stehenden Brüder einig würden (werden), das Wort Gottes und das Evangelium und die Nachfolge Jesu Christi rein zu verkündigen und nur Menschen, die vom Geist Gottes ergriffen wären, durch die Glaubenstaufe in die Kirche aufzunehmen, dann würde bald die Majorität christlich sein, und dann könnte auch der Rat in die Hände der Brüder kommen.
Und so wir auch von Konrad Grebel behauptet, dass er, aus Zürich vertrieben, mit den Bauern, welche in gewaltiger Unruhe und Erregung standen, in der Nähe von Zürich konspiriert hätte. Es wird zwar nicht behauptet, dass er die Bauern zum Aufruhr angetrieben habe, aber es wird gesagt, dass er diese Stimmungen der Bauern für seine Evangeliumsverkündigung in Anspruch genommen hätte.
- - -
Noch schärfer sind die Dinge bei Balthasar Hubmaier zugespitzt. Dr. Balthasar Hubmaier, der in Basel gewesen war, ebenso wie Konrad Grebel und Hans Denck, um die Zeit von 1522 und in den dortigen Kreisen den (einen) neuen Weg gesucht hatte, hat von Waldshut aus zweifellos mit den sich empörenden Bauern verkehrt. In seinem Hause wurden bei einer Haussuchung Schriften gefunden, und zwar wurden in seiner Bibliothek Schriften gefunden, die sich auf den Bauernkrieg bezogen und ganz bestimmte soziale Forderungen der Bauern enthielten, derjenigen Bauernschaften, die an dem Grenzgebiet zwischen Süddeutschland und der Schweiz und im Schwarzwald gelegen sind. Es wird nun von vielen Forschern angenommen, dass Balthasar Hubmaier an der Abfassung der 12 Artikel (der Bauern) teilgenommen hat. Diese Artikel bilden den eigentlichen Auftakt zum Bauernkrieg, freilich einen rein geistigen und sehr maßvollen Auftakt. Nicht die geringste Drohung von Gewalt ist in diesen 12 Artikeln ausgesprochen, sondern einzig und allein eine Fülle von Forderungen, die alle unter das Licht des Wortes Gottes und des Evangeliums Jesu Christi gestellt sind. Aber eben deshalb empörten diese 12 Artikel die damaligen Fürsten und Theologen so sehr, besonders Martin Luther, weil sie politische, wirtschaftliche, soziale Dinge mit den geistigen Dingen zusammenbrachten. Wir werden diese Artikel lesen und werden sehen, dass es durchaus möglich ist, dass Balthasar Hubmaier an der Abfassung einen beratenden Anteil hatte. Dass er sie allein verfasst hätte, ist ganz ausgeschlossen; denn einen solchen ausschließlichen Einfluss hat er bestimmt nicht gehabt. Sondern die erregte Bauernschaft wird ihm alle ihre Forderungen ins Haus gebracht haben, ihre
- - -
Hoffnungen und stürmischen Erwartungen ans Herz gelegt haben. Und dann wird er, als ein (von Christus bewegter) Freund der unterdrückten Proletarier, ihnen geraten haben und ihnen vielleicht auch bei der Formulierung dieser 12 Artikel geholfen haben. Und wenn das der Fall sein sollte, muss man sagen, es ist ihm in wunderbarer Weise gegeben worden, die Forderungen der Bauern zu mäßigen und sie unter das Licht des Evangeliums zu stellen.
So könnte man fortfahren, an vielen Beispielen zu zeigen, dass die Täuferbewegung und die Bauernbewegung in stärkster gegenseitiger Korrespondenz standen. Wie wäre es auch anders möglich gewesen. Im selben Jahre, 1525, sind beide Bewegungen zum öffentlichen Ausbruch gekommen. Es handelte sich um dasselbe Volk, um dieselben bewegten Herzen: In der Täuferbewegung ging es darum, dass die Nachfolge Christi angewandt werden sollte auf alle Gebiete **des sozialen, wirtschaftlichen und politischen Lebens**, auf die Wirklichkeit des menschlichen Daseins; und in der Bauern(kriegs)bewegung handelte es sich darum, dass Staat und Gesellschaft ein Einsehen haben sollten, und nicht weiter so barbarisch unchristlich gegen die damaligen Proletarier, die Bauern, handeln sollten. Es ist undenkbar, dass diese Bewegungen aneinander vorüber gegangen wären. Nicht aber kann an diese Bewegungen miteinander identifizieren. Um das klar zu erfassen, sind wir genötigt, ein wenig in die Bauernbewegung hineinzusehen.
(So möchte ich) einige Gesichtspunkte der deutschen Agrarkultur im frühen Mittelalter in Erinnerung bringen:
- - -
Die ganze Anlage der Feld-, Flur- und Ackerverteilung war im alten germanischen und keltischen Deutschland stark gemeinschaftlich eingerichtet. Jedes freie Mitglied der Dorf- oder Volksgemeinde hatte einen Anspruch auf Acker-, Weide- und Waldnutzung. Die „Allmende“ war das gemeinsame Besitztum und die gemeinschaftliche Erde des kleinen Völkchens oder des großen Dorfes. Das Land war zwischen einzelnen Stämmen aufgeteilt, und die alten Flurrechte waren allmählich zu festen landwirtschaftlichen Siedlungen und deren Ordnungen übergegangen. Acker, Weide, Wiese, Wald wurden nun schon von den alemannischen Zeiten her um 720 in allen Markgenossenschaften rechtlich gesichert. Das sind feste Wirtschaftsgesetze gemeinsamer Unternehmung. Der Markgraf hatte die Aufgabe, diese Markgenossenschaft vor Angriffen und Überfällen von außen zu schützen. Die Nutzungen an der gemeinsamen Mark standen der gesamten Genossenschaft zur Verfügung; der Garten der Markgenossenschaft war der Allgemeinheit gehörig. Die einzelnen Dörfer hatten ebenfalls ein gemeinsames Besitztum, nicht nur an Wald und Wiese, sondern auch am Acker. Die Acker-Allmende wurde während des frühen Mittelalters gemeinsam bearbeitet. Vom agrarkulturellen Standpunkt war sie eine extensive Feld-Graswirtschaft mit dem (gemeinsamen) Rodestück.
Die Allmende, - schwedisch: Allmenninge, - umfasste allen Grund und Boden, der damals noch nicht in Privateigentum übergegangen war. Die Dorfgemeinde also umfasste die Allmende des kleinen Dorfes. Die Markgemeinde umfasste das Land der gesamten Markgenossenschaft. So bildete sich allmählich die Realgemeinde heraus, besonders im
- - -
Süden Deutschlands und in der Schweiz, die einfach auf gemeinsamen Besitz und gemeinsamer, wirtschaftlicher Bearbeitung beruhte.
Daneben stellte sich allmählich das Privateigentum am Boden ein, und zwar fast unmerklich. Es kam dadurch zustande, dass von der Feld-Graswirtschaft (mal Acker, mal Gras) zur Feldwirtschaft übergegangen wurde. Nun wurde die Ackerflur eingeteilt und zwar mit ganz festem Flurzwang. Jeder durfte nur (das) bauen, was die Gemeinde wollte. Aber da ein jeder, der zum Bauerndorf gehörte, dann immer ein bestimmtes Stück Acker zum Bearbeiten bekam, so hat sich das Eigentum eingeschlichen, während die Weide noch lange, lange Zeit, teilweise bis heute, Allmende geblieben ist. Der einzelne Bauer bekam in der Regel eine Hufe. Diese Hufe betrug im Durchschnitt etwa 30 Morgen. Zwischen diesen Hufen herrschte der feste Flurzwang im Wechsel der Früchte, in der Zeit der Bestellung und ebenso in der Zeit der Ernte. Die Weidewege, Überfahrtsrechte, Weiderechte, Feldwachen (Feldwege?), Waldflächen und Gewässer waren vollständig gemeinschaftlich. Infolgedessen war auch die Schweinemast (-zucht?) Gemeindesache; denn das Waldgebiet(?) stellte ja die wichtigste Nahrung dar. Gemeinsam war auch die Kuhweide. Das Vieh wurde auf die gemeinschaftliche Weide getrieben und gemeinschaftlich gehalten. Erst ganz allmählich kam es auch hier zum Privateigentum. Rodung und Anbau (Neuanbau?) waren natürlich erwünscht, um Tochterdörfer zu gewinnen. Die Allmende wurde gerodet. Dadurch entstanden zunächst gemeinsame Besitztümer, aber gerade in diese gemeinsamen Besitztümer hat sich das Eigentum wieder eingeschlichen, der Großgrundbesitz. Er war
- - -
der gefährlichste Gegner der Dorfgemeinschaft.
Der Großgrundbesitz ist leider ebenso durch die frommen Leute wie durch die ritterlichen Leute eingeführt worden. Die ritterlichen Leute haben nicht gern gemeinschaftlich (landwirtschaftlich) gearbeitet. Sie hatten ein wenig Wiese, die sie nicht selber mähten; aber sie hatten nicht gern große Äcker, die überließen sie den Bauern. Wie haben sie für ihr Leben gesorgt? Das haben sie durch Herrschaft (Herrschen) getan. Der Ritter oder der Adlige hat durch Herrschen gewirtschaftet, Herrschen im wörtlichen Sinne des Wortes. Er war der Herr. Er war zunächst der Schutz- und Gerichtsherr, und er wurde dann der Herr über Leib und Leben der anderen. Die anderen waren ihm leibeigen, ihr Leben war ihm zum Eigentum gegeben. Also nicht das Land wurde zum Eigentum, sondern die Leiber wurden zum Eigentum. Das Land blieb zunächst in den Händen der Allmende, und nur die Menschen wurden Eigentum. Daran erkennt man die abgründige Teufelei dieser Entwicklung.
Abgesehen von einigen wenigen Gegenden in Norddeutschland nahm die Selbständigkeit der Landwirtschaft immer mehr ab. Wohl blieben noch Wiesen übrig, in denen Heu gemacht wurde. Aber im großen Ganzen gewannen der Adel und die Kirche über die Menschen, über die Leibeigenen solche Gewalt, dass die Bewirtschaftung, von welcher der Adel und die Kirche lebten, in Renten, in Zinsen, in Abgaben, in Gebühren und in Leistungen bestand, nicht in Landeigentum zunächst. Auch dazu gehörten wirtschaftliche Fähigkeiten, nämlich Fähigkeiten des Herrschens. Auch die kleinste Grundherrschaft hatte
- - -
etwas von einem Staat an sich; denn der Herr Graf oder der Herr Baron hatte die Gerichtsbefugnisse. Die suchte er zu seinen Gunsten zu steigern, indem er immer mehr Steuern einführte. Wirtschaftliche Arbeit hatte er nur, wenn er Tiere jagte. Diese Jagd war für den Haushalt des Ritters sehr bedeutungsvoll. Deshalb spielte die Jagd in adeliger Sitte eine Hauptrolle. Gerade dieses Jagdgebiet sucht der immer stärker werdende Ritter und mit ihm die Kirche den Bauern gegenüber zu behaupten. So entstand eine Belastung der Bauern, die im 13. Jahrhundert, im 14. Jahrhundert und besonders im 15. Jahrhundert ungeheuer angestiegen ist. Durch den Adel und den Klerus, die Geistlichen, wurden die Bauern mehr und mehr belastet.
Bis ins 14. Jahrhundert hinein hatte sich trotzdem der Bauernstand noch recht achtungsgebietend erhalten. Aber von der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts an und im 15. Jahrhundert ist die Bedeutung des Bauern immer mehr herabgedrückt worden. Diese Tatsache hing auch mit der Entwicklung der Städte zusammen. So lange der Bauer nur mit den Rittern zu tun hatte, konnte er sich seiner Haut erwehren; denn der Bauer brauchte den Ritter. Der Ritter führte ihn in den zahlreichen Fehden und Grenzschwierigkeiten. Darauf beruhte die Macht des Ritters, denn er war der Offizier des Dorfes. Dadurch, dass der Ritter auf die Gefolgschaft der Bauern angewiesen war, musste er immer wieder zu einem erträglichen Zustand mit seinen Bauern kommen.
Anders die Städte. Die Städte haben durch ihre neue Kultur und durch ihren Bürgerhochmut von 1400-1500 an das Landhandwerk
- - -
unterdrückt und ein umso schärferes Zunftrecht in der Stadt eingerichtet. Sie hatten keinerlei Verständnis für die Bauern, und die Städte haben mehr und mehr die Bauern sich zu Leibeigenen gemacht. Die Ratsherren der Städte waren für die Bauern genauso Herren wie die adligen Ritter. Und die Bauern waren ihnen genauso leibeigen. Der Hochmut der städtischen Handelsleute und der Patrizierfamilien wurde so maßlos, dass der Bauer fast dem Rindvieh gleich geachtet wurde.
So wuchs denn während des 15. Jahrhunderts die innere, auch die seelische Empörung der Bauern mehr und mehr. Dass der Bürgerhochmut mit dem der Ritter gleichgekommen war, kränkte die Bauern, weil ja die Städte aus einfachen, landwirtschaftlichen Verhältnissen heraus gewachsen waren, also ursprünglich kleine Landstädte gewesen waren. So kam eine immer mehr aufständische Gesinnung gegen die Städte wie gegen die Edelleute hoch. Die Leibeigenschaft wurde mehr und mehr als eine Entehrung und Versklavung, als Raub an der christlichen Freiheit empfunden. Besonders dass die Ritter und die Städte nicht nur die vorhandenen Bauern, sondern auch ihre zukünftige Nachkommenschaft mit dem Bann der Leibeigenschaft verstricken wollten, hat dem Bauern immer mehr einen Hass eingeflößt. Gleichzeitig empörte sich der Bauer, dass sein Recht an der Allmende mehr und mehr den Rittern und Städten und Fürsten zufiel, dass also gerade das, was gleichsam an heiligem Gemeinschaftsgut noch übrig war, ihnen durch die hohen Herren geraubt wurde. Daher erklärt sich in den 12 Artikeln der starke Appell an den unvordenklichen Gebrauch.
- - -
Der Bauer war der Überzeugung: Wald, Weide, Wasser sind Allmende, das heißt Wald, Weide, Wasser gehören Gott und allem Volk. Niemals kann Wald, Weide und Wasser Privateigentum sein, außer wenn Wald, Weide und Wasser durch blutige rohe Gewalt geraubt worden sind, wie man es oft erlebt hatte.
Ebenso empörten sich die Bauern über die Arbeitsleistungen; denn die Leibeigenschaft war ein Frondienst. Es wurde von den Bauern gefordert, dass sie Flurdienst, Botendienst, Jagddienst und andere Arbeiten für den Herrn leisten mussten, ohne dafür irgendwie entschädigt zu werden. Die Jagd aber nahm mehr und mehr den Charakter der Massentötung, der Hetzjagd an. Besonders darüber waren sie entrüstet, dass das Jagdrecht über das Bauernfeld ausgeführt werden konnte. Man spricht deshalb vom Jagdteufel. So waren die Bauern und die Grundherren einander als feindliche Parteien entgegengetreten.
So wurde auch der Zehnte als eine gewaltige Last empfunden. Der Zehnte war wie eine Doppelbesteuerung, dreifache Besteuerung, die lästigste aller Abgaben. Der große Zehnte war: 1/10 der Heuernte, 1/10 der Feldfrucht, 1/10 des Viehs. So wurde nicht nur das Heu zum zehnten Teil genommen, sondern auch das Vieh. Da war das Heu schon besteuert, und wenn man 1/10 des Viehs abgeben musste, war das Vieh ebenfalls besteuert. Der Adlige, die Kirche und die Stadt nahmen das.
Die lästigste Form war der kleine Zehnte, der besonders in den Händen der Kirche war. Das war der zehnte von den Früchten, die in den Gärten angebaut wurden und besonders feine Kleinarbeit erforderten. Dieser Zehnte lag fast ausschließlich in den Händen der Geistlichen. Hier war eine Hauptwurzel der Empörung der Bauern gegen die Geistlichen, dass sie vom dem Schweiß der Frauen ihre Steuer erhoben. Das hat den Bauern nicht gefallen und konnte ihnen auch nicht gefallen.
So stand es also im 15., 16. Jahrhundert. Die Klöster, Ritterorden, Pfarreien bedurften immer größerer Einkünfte. Die Territorialverwaltungen der späteren Fürstentümer hielten sich auch eine Landespolizei und Schreiber. Nichts war bei den Bauern so unbeliebt wie der bewaffnete Polizist und der Schreiber mit der Gänsefeder. Sie waren die verhasstesten Menschen auf dem Bauernhof; denn beiden fühlte sich der Bauer nicht gewachsen. Er konnte mit dem Polizisten nicht kämpfen, mit dem Schreiber kein Wettschreiben halten.
Gleichzeitig wuchs in dem germanischen Bewusstsein eine immer tiefere Verbitterung darüber, dass das römische Recht vordrang, dass das Vererbungsrecht und die sonstigen scharfen Besitzrechte zunahmen, und dass der Anteil des Volkes mehr und mehr zurücktrat. Der ganze Bauernstand fand sich proletarisiert, entwürdigt, der Menschenrechte und des christlichen Bildes, des Ebenbildes Gottes beraubt. Der Bauer war deklassiert. Es kam zu einem ländlichen Proletariat, was in armen Gebirgsgegenden die furchtbarsten Ausmaße erreicht hat. Wir müssen bedenken, dass in der damaligen Zeit die Schweizer gegen Karl den Kühnen gewaltige Erfolge erzielten, und dass sich die einfachen Landleute den berittenen Rittern wiederholt als überlegen erwiesen haben. So war es in der damaligen Zeit, also am
Ende des 15. Jahrhunderts, in der Schweiz zu einer Befreiung gekommen, die das Joch der Knechtschaft abgeschafft (abgeworfen) hatte, wie die Bauern meinten: durch Bauernkraft. Und so verbreitete sich damals (wie heute auf dem Bruderhöfen) eine wahre Begeisterung für die Schweizer. Alle Bauern blickten auf die Schweizer, besonders natürlich die Bauern in Süddeutschland. Das bäuerliche Fußvolk der Schweizer war für die deutschen Bauern ein Vorbild zum zukünftigen Bauernkrieg, zur zukünftigen Bauernrevolution. Insofern ist tatsächlich genau wie die Täuferbewegung auch der Bauernkrieg von der Schweiz ausgegangen. Die Programme radikaler Umwälzung führten dann schon im 15. Jahrhundert zu Bauernverschwörungen. Sehr interessant war das Kennzeichen: der Bundschuh. Der primitive Bauernschuh wurde dem Ritterstiefel entgegengesetzt. Das Zeichen des Bundschuhs war der Stolz der Bauerntracht gegen die vornehme Ritterkleidung. „Wir Proletarier wollen euch schon in der Fahne zeigen, dass wir arme Leute mit dem Bundschuh sind, mit dem Holzschuh. Keine „feinen Leute kommen hier“, nein, „hier kommen starke, einfache Proleten mit dem Bundschuh.“ Sehr interessant, dieses Klassenbewusstsein, dieser Stolz der Unterdrückten. Auch von anderen Bewegungen werden wir noch hören.
Nun kam dann die Reformation und die Bewegung der Brüder, die man die Täufer nennt. Fühlt ihr den Zusammenhang, die Beziehung dieser beiden Bewegungen, die keineswegs als Einheit aufgefasst werden dürfen. Die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse des 15. Jahrhunderts waren ebenso wie die religiösen Verhältnisse(?) der Ursprung der Bauernbewegung. Im 15. Jahrhundert wurde die eigentliche Geldwirtschaft eingeführt und durch die großen Handelsstraßen die Weltwirtschaft durchgesetzt. Die Riesenhandelsstraßen, die durch Basel führten, durch Bozen und Nürnberg führten, die Hansastädte mit ihren Wasserstraßen, die hinauf nach England und an die Ostsee führten, brachten in der Geldwirtschaft (Geldherrschaft?) eine gewaltige Veränderung hervor. Deshalb waren die Städte so reich geworden. Deshalb waren die Städter so hochmütig geworden. Sie taten es den Adligen gleich. Sie hatten, was sie wollten: Samt und Seide. Gleichzeitig nahmen die Güterpreise, die Getreidepreise, die Preise aller ländlichen Produktion Ausmaße an, die jedes Mal für die Bauernschaft ungünstig waren.
Die Grundherrschaft übte mehr und mehr Gewalt und Tyrannei über die Bauern aus. Die römische Jurisprudenz des Privateigentums wurde immer mächtiger. Die Gemeindefreiheit und die Allmende der Dörfer wurden mehr und mehr unterdrückt, und die eigentliche Tragkraft der Bewegung wurzelte in einem Glauben an ein Gottesreich der Freiheit und der Gleichheit. Und das ist die Verbindung mit der Bewegung der Brüder. Der gesamte Bauernkrieg wird getragen von dem Glauben an ein Gottesreich der Freiheit und Brüderlichkeit. Dieser Glaube war schon sehr alt verankert, wie z.B. im Judentum und im Proletariat (Proletariertum?), aber schon in der griechischen Sozial-Philosophie wie bei Plato und anderen, war dieser Glaube an das Gottesreich der Brüderlichkeit den Menschen in das Herz gestrahlt. Und damit waren kommunistische Ideen, auch aus der altkatholischen Kirche, die ..?..-Ideen der Mönchsklöster, der Bibel und der Apostelgeschichte in die Bauernschaft eingedrungen. Durch die franziskanischen Mönche, durch die Wanderprediger der Waldenser und anderer Bewegungen, durch religiöse Genossenschaften und Bruderschaften aller Art wurde dieser brüderische Gedanke der Freiheit und Gleichheit (Brüderlichkeit?) einer
kommunistischen Gemeinschaft im Sinne Christi mehr und mehr schon während des (vor dem?) 15. Jahrhunderts, also vor der Reformation, in den Dörfern verbreitet und fand großen Anhang (Anklang?).
Am Ausgang des 12. Jahrhunderts wurde das Evangelium aeternum (Eterum?) verkündet, das Evangelium, welches behauptete, dass die Enterbten und Erniedrigten das Erdreich besitzen werden, das Evangelium, welches behauptet: Die Erde gehört allein Gott, und deshalb gehört sie allen Armen, Enterbten und allen Erniedrigten. Diese Botschaft von Joachim von Floris (Flore) wurde durch eine Unzahl von wandernden Brüdern, besonders von Waldensern, verbreitet. Überall wurde vom göttlichen Recht gesprochen, nicht von einem menschlichen Recht, bei dem ein Mensch gegen einen anderen Recht hat. Sondern jetzt wurde von einem göttlichen Recht gesprochen, in welchem Gott Recht hat gegen die Menschen. Dies bedeutet, dass die Menschen sich erniedrigen von ihrem Reichtum und ihrer Herrschaft (Wichtigtuerei), und dass sie einfach alle Brüder werden. Schon die „Reformation des Kaisers Sigismund“ 1438 hatte in diesem Sinne eine starke Wirkung ausgeübt. Diese Reformation wurde im Laufe des 15. Jahrhunderts mehr und mehr auf das weltliche Gebiet ausgedehnt. Als Luther und Zwingli aufstanden (und die Brüder kamen) und Carlstadt und Münzer, da erhoben sich die Bauern und sagten: Jetzt wird das göttliche Recht (Reich?) offenbar; jetzt wird die christliche Freiheit ausgestaltet und begründet werden.
Was vorher die Erhebung des Bundschuhs gegeben hatte, von der wir schon sprachen, (was die Erhebung) 1492 im Allgäu und um Kempten herum, und was ebenso die Bauernrevolte von 1476 gegeben hatte, was die Bauern im Bistum Speyer im Jahr 1502 gesucht hatten, was 1514 in der Erhebung, Errichtung, Richtung (?) des Armen Konrad in Württemberg begonnen hatte, was sich 1513 unter den Bauern in der Umgebung von Bern und Zürich rege gemacht hatte, brach jetzt in der Zeit von 1525 stärker aus als jemals zuvor, wurde aber auch gewaltsamer und roher niedergeschlagen als je zuvor.
Die Reformatoren und besonders die sogenannten Täufer, die in Wirklichkeit sich Brüder nannten, sprachen von der Erneuerung der Kirche und Gemeinde und erklärten, dass die Gemeinde wieder zu ihrer ersten Reinheit und Liebe zurückkehren müsse. Luther schrieb gegen den Adel, von der babylonischen Gefangenschaft der katholischen Kirche und für die evangelische Freiheit. Diese drei Schriften schlugen wie Blitze in die Bauernschaft ein. Nun hofften sie, dass endlich politische Führer da wären, die die Macht des Adels und der Kirche brechen würden. Und so erwarteten die Bauern von Männern wie Luther und Zwingli die göttliche (größte?) Hilfe (Umwälzung?), durch welche die Ungerechtigkeit gestürzt und die Gerechtigkeit (des Reiches) Gottes heraufgeführt werden sollte. So kam es zu dem Revolutionsprogramm, gegründet auf das Evangelium, das Luthers maßlose Entrüstung hervorrufen musste, weil es das Geistliche und das Weltliche vermischte. Die Adelserhebung war gescheitert, wie wir von der Geschichte Säckingens und Ulrichs von Hutten wissen. Jetzt wollten die Bauern sich erheben. Hätten sich Adel und Bauern vereinigt, wer weiß was geschehen wäre!
Nun wurden die sozialen Forderungen zusammengestellt mit den geistlichen Forderungen der Bauern. Was einem Ulrich von Hutten nicht gegeben war, war den Bauern gegeben. ((Susis
Übertragung lautet: Was Ulrich von Hutten der Adels-Regierung (?) nicht zu geben vermochte, war den Bauern gegeben in ihrer Regierung(?) )). Sie sprachen von der Erlösung durch Christus, von der Freiheit in Christus, von der Unrechtmäßigkeit der Leibeigenschaft und Sklaverei der Bauern. Sie lehnten die Leibeigenschaft ab, verwarfen den Zehnten, verlangten, dass das Allmende-Recht der gemeinschaftlichen Bewirtschaftung des dörflichen Landes wiederum eingeführt werden sollte.
Es kam also hier zu Forderungen, die wirtschaftlich, sozial und religiös zugleich waren, ja, zu einem politischen Ziel einer völligen gesellschaftlichen Neugründung mit einer gänzlich neuen und doch uralten Ordnung, auch der Dinge des Eigentums. Alle diese Erörterungen hingen also aufs Tiefste mit der urchristlichen Bewegung und mit der Reformation zusammen, ohne aber doch in bestimmten Vertretern der Reformation ihren Ursprung zu haben.
1524 hatte es im südlichen Schwarzwald stark zu gären begonnen. 1525 war im Kemptener Gebiet die Forderung formuliert worden, die schwäbischen Bauern reichten ihre 12 Artikel ein. Faber berichtet, dass man bei einer Haussuchung in Balthasar Hubmaiers Wohnung sonderbare Bauernartikel gefunden habe, daraus sich ergab, dass die Stühlinger Bauern und die Bauern im Klettgau die ersten gewesen sind, die sich gegen den Staat erhoben. Was nun die 12 Artikel verlangen, die für uns viel wichtiger sind als der blutige Hergang (des Krieges) selbst, (ist folgendes):
Der erste Artikel verlangt, dass freie Pfarrwahl (Pfarrerwahl) durch die Gemeinde (gestattet werde). Der Pfarrer sollte nur das heilige Evangelium predigen, lauter und rein, und damit den wahren Glauben verkünden.
Der zweite Artikel betrifft die Abschaffung aller ungerechten Abgaben, vor allem des kleinen Zehnten.
Der dritte Artikel fordert die Abschaffung der Leibeigenschaft und sagt folgendes: Angesehen dessen, dass Christus alle Menschen mit seinem kostbaren Blutvergießen erlöst hat, den Kuhhirten ebenso wohl wie den höchsten Herrscher, keinen ausgenommen, kann nicht ein Mensch (Bruder) der leibeigene Sklave eines anderen sein.
Im fünften Artikel wird das nötige Brenn- und Bauholz gefordert, und zwar immer nur mit Wissen der ganzen Gemeinde, nie nach dem Willen des Herrn.
Der sechste und siebente Artikel richten sich gegen die Sklavendienste, die Frondienste und gegen Abgaben.
Der achte Artikel (richtet sich) auch gegen unerschwingliche Abgaben und Zinsen.
Der neunte Artikel (wendet sich) gegen willkürliche Strafen durch die Herren und fordert ein Urteil nach geschriebenen Recht.
Der zehnte Artikel verlangt, dass das Gemeindeeigentum der Allmende dem Bauerndorf zurückgegeben werden soll, denn die Herren haben die Wiesen und Äcker und Wälder
widerrechtlich der Gemeinde weggenommen, denn diese gehören, ebenso wie das Wasser, Gott und der Allgemeinheit.
Der elfte Artikel (richtet sich dagegen), dass das sogenannte Besthaupt (genommen werden kann). Wenn der Hausherr gestorben war, konnte der Ritter kommen oder der Mönch kommen und sich das beste Pferd, die beste Kuh aussuchen (von dem), was im Hause war. Das sei eine Beraubung der Witwen und der Waisen.
(Im zwölften Artikel heißt es): Wenn einer oder mehrere dieser Artikel dem Wort Gottes nicht gemäß wären, wollten wir, (wo uns selbige Artikel mit dem Wort Gottes als unziemlich nachgewiesen werden), davon absehen, sobald man es uns mit Grund der Schrift erklärt. Und wenn uns gleich etliche Artikel zugelassen würden und es befände sich, dass sie unrechtmäßig (unrecht) wären, sollten sie abgeschafft werden und für nichts mehr gelten.
Das deutet darauf hin, dass hier Brüderische mitgeholfen haben. Man kann sich nicht gut denken, dass das die erregten Bauern aus ihren Bauernköpfen erfinden konnten ohne den Geist der Gemeinde, wohl aber, wenn die Bauern ergriffen sind von dem Geist des Waldensertums oder des Brudertums.
Ich glaube, dass die Bauernbewegung mit der brüderischen Bewegung im Zusammenhang zu sehen ist, wie ja sehr oft in gewaltigen Zeiten sich verschiedene Extreme berühren. Man darf deshalb die brüderische Bewegung nicht des blutigen Aufruhrs beschuldigen, sondern in solchen bewegten Zeiten ist alles in Bewegung miteinander und schwingt miteinander (in solchen Zeiten ist alles, was bewegt ist, in Berührung miteinander und schwingt miteinander). Es muss alles, was lebendig ist, mit der wahrhaften Christus-Bewegung (wahrhaft christlichen Bewegung) in lebendige Beziehung treten (in gegenseitige Berührung treten). Also man sieht, die Bauern suchten nicht in roher Gewalt und unsinnigen Forderungen ihre Hilfe, sondern sie suchten Gerechtigkeit und Verständnis. Erst als man ihren Wünschen nicht entsprochen hat, haben sie zum Schwert gegriffen.
Münzer war zu den Bauern gestoßen und ihr apokalyptischer Prophet geworden. Von einer tiefen Mystik aus feuerte (forderte) er sie in fanatischer Weise zum Kampf an (auf), dass nun endlich das Reich Gottes aufgerichtet werden sollte. Darauf (darüber) empörte sich Martin Luther so, nachdem er sich beinahe auf die Seite der 12 Artikel (gestellt hatte), dass er jetzt die Schrift: „Ermahnung zum Frieden auf die 12 Artikel der Bauernschaft“ bereute und die Schrift „Wider die räuberischen und mörderischen Rotten der Bauern“ geschrieben hat, von der wir schweigen möchten, (weil sie zum schonungslosen Zuschlagen (Totschlagen) und Vernichtungskampf aufgefordert hat). Und wirklich wurden die Bauern 1525 völlig geschlagen bei Frankenhausen, bei Mühlhausen, in Pfeddersheim. Sowohl der Odenwaldaufstand, der fränkische Aufstand, der sächsische Aufstand, der Schwarzwaldaufstand wurden geschlagen, auf einmal geschlagen durch alle die fürstlichen Adligen (Fürsten und Gewaltigen) und die Städte, die ihre gewaltigen Armeen gegen sie geschickt hatten. Die Niederwerfung geschah auf die roheste Weise. Tausende von Bauern wurden, nachdem sie besiegt waren, als Gefangene abgeschlachtet von der sogenannten christlichen Obrigkeit.
Wenn man nun weiter fragt, inwieweit hat (nun) Balthasar Hubmaier mit diesem ursprünglichen Aufruf der 12 Artikel in Verbinddung gestanden, so sind allerdings einige Anknüpfungspunkte in seinem Leben gegeben, die seine Beteiligung als möglich erscheinen lassen. Er hat im Schwarzwald, in der Schweiz, in Mähren gewirkt. Sein Leitsatz war: Die Wahrheit ist untötlich. Sie wird auferstehen, regieren und triumphieren. Die Wahrheit kann gefangen werden, gegeißelt werden, gekreuzigt, ins Grab gelegt werden, sie wird aber stets siegreich (sieghaft) auferstehen (und triumphieren).
Bathasar Hubmaier ist in Friedberg geboren, in der Nähe von Augsburg. Balthasar Hubmaier (Er) war von kleiner Gestalt und dunkler Gesichtsfarbe, sehr geistvoll, lebendig und lebhaft im Gespräch. Er wird in Freiburg im Breisgau als Student 1503 mit hohen Lobsprüchen seiner Lehrer bedacht. 1510 (zum) Priester (geweiht). (In Ingolstadt wurde er zum ) Lizentiat und Doktor der Theologie (promoviert). 1515 Professor (Prorektor an der Universität), später Prediger und Pfarrer an der Domkirche in Regensburg. Er kümmerte sich bereits hier um wirtschaftliche Fragen, besonders um die Judenfrage, bei welcher Balthasar Hubmaier den Wucher aufs schärfste bekämpfte, sodass er sogar bei der Ausweisung der Juden (den stärksten) Anteil hatte.
Im Frühjahr 1521 (trat er eine Pfarrstelle in) Waldshut, nahe an der Rheinpassage, nahe der Schweiz, an. Im Sommer 1522 begann seine innere Wandlung und zwar in Basel in dem dortigen Freundeskreis. Er studierte die Schriften Luthers, studierte das Evangelium und die Paulinischen Briefe. Für kurze Zeit ging er wieder nach Regensburg und kehrte dann nach Waldshut zurück. Er stellte sich mehr auf die Seite der Schweizer als Luther. 1523 verhandelte er mit Zwingli über die Taufe. „Da hat Zwingli mir recht gegeben, dass die Kinder nicht getauft werden sollen, ehe sie im Glauben unterrichtet wären.“ Er begann mit seinen Neuerungen in Waldshut selbst. Am 28. Oktober 1523 nahm er an dem Religionsgespräch der Züricher im Rathaussaal teil. Er sprach sich damals in Zürich scharf gegen die Messe und die Bilderverehrung aus und erklärte, dass allein die Bibel (solche Fragen entscheiden müsse). Die Messe sei kein Opfer, das Abendmahl sei eine Verkündigung des Bundes Christi, Seines bitteren Leidens und Seiner Selbstaufopferung. „Wo ich für einen anderen nicht glauben kann, - denn jeder muss für sich selbst glauben, - kann ich auch keine Messe für ihn lesen (lassen).“
Als Kanzelredner hatte er schon 1523 den größten Anhang. Mit der alten Kirche hatte er vollständig gebrochen. Gleichzeitig (stand er in) schärfstem Gegensatz zur österreichischen Regierung. Er hielt seine 18 Schlussreden, die das ganze christliche Leben betreffen. (Daraus geht hervor, dass er) ähnlich wie Zwingli, Grebel, Manz und Blaurock dachte. Die Bürgerschaft trat mehr und mehr auf seine Seite. Der Gottesdienst in Waldshut wurde deutsch (gehalten). Alle Bilder wurden aus den Kirchen beseitigt. Fastenzeiten wurden abgeschafft. Er heiratete Elisabeth Hügeline, eine Bürgerstochter aus der Reichenau, die willig und mutig seine Schicksale, auch seinen Tod, teilte.
Alle Versuche der Regierung, die alte Ordnung (wieder herzustellen) (zu erhalten), scheiterten. Deshalb stellte sich die Regierung auf den Standpunkt der Gewalt und wollte die Stadt zurück erobern. 1524 wich Hubmaier der Gewalt und ging nach Schaffhausen. (Sehr
bald erhielt er) Warnungen, dass man ihn verhaften wollte. Er wollte in der Freiheit (Freiung) (in Schaffhausen) bleiben, und die Stadt lehnte das Ansinnen (der österreichischen Regierung) ihn auszuliefern ab. In drei Schriften (Schreiben) erklärte er sich bereit, alles zu verteidigen, was er seit zwei Jahren gelehrt ha(e)tte. (Um sich gegen den Vorwurf der Ketzerei zu verteidigen, veröffentlichte er die Schrift): „Von Ketzern und ihren Verbrennern“. Er fährt nach Waldshut zurück, das in offenen Gegensatz zu Österreich getreten war. Und nun ist das Interessante, dass Balthasar Hubmaier doch in gewisser Ähnlichkeit wie Zwingli die Seele des politischen Widerstandes gegen Österreich wurde. Noch hielt Balthasar Hubmaier an der Richtung Zwinglis fest. Grebel, Manz, Blaurock und Wilhelm Reublin waren bereits gegen Zwingli aufgetreten und erklärten, dass die Kindertaufe keine Taufe sei. Man müsse erst zum Glauben kommen und dann nach christlicher Ordnung und Einsetzung getauft werden. Am 17. Januar 1525 kam es in Zürich zu dem bekannten Religionsgespräch. Hubmaier lässt die Kindertaufen fallen. (Einige der Züricher Wiedertäufer fanden sich zu einem Besuche bei Hubmaier in Waldshut ein.) Am 2. Februar 1525 erschien seine „Öffentliche Erbietung an alle christgläubige Menschen“. Er wolle erweisen, dass die Kindertaufe (keine Begründung in der Schrift habe). Das wolle er tun mit deutschen, klaren, eindeutigen Schriften. Die Bürgerschaft ging fast völlig mit Hubmaier mit; aber die schweizerischen Reformatoren nahmen Anstoß und wurden Gegner Hubmaiers. Die Messe hielt er deutsch, später schaffte er sie ganz ab und ließ alle Altäre aus den Kirchen entfernen. Das Abendmahl feierte er an einfachen Tischen und ließ sich endlich am Ostertag 1525 von Wilhelm Reublin taufen.
Zwingli hatte inzwischen die Schrift geschrieben „Von der Taufe, der Wiedertaufe und der Kindertaufe“. (Als Antwort) schrieb Hubmaier „Vom christlichen Tauf der Gläubigen“. Der Rat von Zürich berief ein abermalige (Religions)gespräch ein. Konrad Grebel, Felix Manz, Georg Blaurock wurden ins Gefängnis gesetzt, (später aber, - nach sechs Monaten – entkamen sie). Die Wiedertaufe wurde verboten, die Kindertaufe wurde staatlich befohlen. (Hubmaiers Schrift trägt das Datum) 30. November, (wurde aber erst im nächsten Jahre in Nikolsburg in Mähren gedruckt). Von da an erschienen weitere Drucke Hubmaiers in Nikolsburg; denn dort hat er dann seine Ideale und Arbeitsart durchgesetzt, die (was?) er in Waldshut nicht erreichen (durchsetzen) konnte. Hand in Hand (mit dieser Tätigkeit ging sein) politischer Widerstand. (Die Bauernbewegung) hat zweifellos auch von Hubmaier eine starke, vielleicht schon führende Unterstützung gefunden. Balthasar Hubmaier wird von einigen sogar als einer der ersten Anfänger des ganzen Bauernkrieges angesehen. Später hat er eine Schrift herausgegeben, die da heißt: „Eine kurze Entschuldigung“, in der er sagt: „Dass ich als ein Aufwiegler hingestellt werde, darin geht es mir so wie Christus. Er musste auch ein Revolutionär (Aufrührer) sein). Ich bezeuge mit Gott und Menschen, dass ich gearbeitet habe in Schriften und Predigten, damit man der Obrigkeit gehorsam wäre, denn sie ist von Gott. Wahr ist aber, dass sie uns mit Gewalt und wider alles Recht vom Wort Gottes abbringen wollten. Das ist unsere einzige Klage gewesen.“ Auch die Bürgerschaft Waldshuts wollte Österreich gehorsam sein, wie es in ihrer „Ehrerbietung“ zum Ausdruck kommt: „Wenn ein Stein zehn Klafter unter der Erde wäre, der nicht gut österreichisch wäre, wollten wir ihn mit den Nägeln herauskratzen.“
Hubmaier war kein Urheber des Bauernkrieges, aber zweifellos hat er in Waldshut in engem Bunde mit den Bauern gestanden. Zweifellos hat er sie seelisch (innerlich) unterstützt und auch von ihnen Hilfe bekommen. Es hat die Waldshuter beraten und Briefe für sie geschrieben. Er hat die Bauern-Artikel erweitert und ausgelegt und den Leuten gesagt, dass sie sie als christlich und vernünftig annehmen sollten. Für Waldshut handelte es sich um die Freiheit (der Lehre) des Evangeliums. Wenn man ihnen und den Bauern diese gewährte, so wären sie bereit, alle Pflichten der Obrigkeit zu erfüllen. Die Bauern und die Waldshuter kämpften für (scharten sich um) das Evangelium. Die Regierung versuchte beide mit einem Mal zu schlagen, sowohl die Bauern wie auch die radikal evangelischen Waldshuter. Die Bauern wurden bei Grießen besiegt, dann wurde Waldshut erobert. Mit Mühe gelang es Hubmaier am 5. Dezember 1525 sich zu retten. (Wir wissen), dass er flüchtigen Fußes und zerrissenen Gewandes nach Zürich kam und im Juli 1526 in Nikolsburg eingetroffen ist.
Die 12 Artikel …
Die Täuferbrüder wollten keineswegs eine blutige Revolution … Diese Bewegungen hängen völlig zusammen. Die Bauern- und Proletarierbewegung und die Evangeliumsbewegung der Gerechtigkeit. Die letztere erkannte, dass aber die Gemeindebewegung (des Heiligen Geistes) der Gemeinde Jesu Christi keinesfalls diesen blutigen (gewalttätigen) Weg geht (gehen kann) wie den Bauernkrieg. Deshalb ist die hutterische Bruderschaft gegründet (worden), damit alles was (an Gerechtigkeitsforderungen) in der Bauernschaft, im Proletariat vorhanden war, praktisch erfüllt würde, ohne Gewalttat. Man sieht, dass die hutterische Bewegung die Erfüllung, sowohl für die innersten Sehnsüchte der Bauern und Proleten ist, wie die Erfüllung der Sehnsüchte aller derer, die nach dem wahren Evangelium, nach dem Frieden und der Gerechtigkeit des Reiches Gottes verlangt haben.
Wenn von Konrad Grebel behauptet wird, dass er in der Züricher Gegend mit den unruhig gewordenen Bauern konspiriert hätte, so möchte ich folgendes schließen. 1513 waren in der Nähe von Zürich und Bern Bauernunruhen. Um ein Haar wäre es schon damals zu einem blutigen Aufstand gekommen. 1522-1525 waren ebenfalls die stärksten Bauernunruhen in der ganzen Umgegend von Zürich und Bern, aber es kam nicht zum blutigen Aufruhr. Gleichzeitig ist in Zürich und Basel, und nachher auch in Bern, die Bewegung entstanden, die die Brüderischen 1525 zur Taufe führte.
Im Sommer 1525 brach der Bauernkrieg aus, nicht in der Nähe von Basel, Zürich und Bern. Es wird gesagt, das liegt an der Klugheit Zwinglis, dass der Bauernkrieg nicht in der Nähe von Zürich ausbrach. Er hätte die Leibeigenschaft abgeschafft, wäre den Bauern entgegen (näher) gekommen. Ich glaube vielmehr folgendes: Die Erregung der ganzen Bauernschaft ging nach dem Reiche Gottes und Seiner Gerechtigkeit. Die Bauern konnten es nicht ertragen, dass diese unerträgliche Ungerechtigkeit weiter auf ihnen lastete. Jetzt kam von der einen Seite, vom Schwarzwald her, der Aufruf zum blutigen Aufruhr (Aufstand). – Von der anderen Seite kam durch Georg Blaurock der Ruf des Evangeliums mit der Hoffnung auf ein wirkliches Gemeindeleben in Gemeinschaft und in der Ebenbürtigkeit. Da brauchten sie keinen blutigen Aufstand. Ich bin sicher, dass die erregtesten Elemente durch die Reden der
Brüder von Zürich aus gewonnen wurden, sodass der blutige Aufstand nicht in der Nähe von Zürich ausbrach.
Es ist etwas ganz Wunderbares, diese Taufbewegung, etwas unendlich Wunderbares. Ich hoffe, ihr werdet das verstehen, nicht um vom 20. Jahrhundert in das 16. Jahrhundert zu fliehen, sondern dass wir das um des 20. Jahrhunderts willen tun. Jetzt ist es Zeit, dass es abermals geschehe, dass von der Nachfolge Christi aus das Soziale, Wirtschaftliche und Politische angegriffen wird als Gemeinschaft des Reiches Gottes! Der Tag des Herrn ist da, und es kommt das Reich der Freiheit und Brüderlichkeit, und wir dürfen es durch das Beispiel unseres gemeinsamen Lebens allen Menschen nahe bringen! Es lohnt sich, dafür in den Tod zu gehen, wenn wir unsere ganze Liebe den unterdrückten Proletariern hingeben; wenn man sie auch nicht schreien hört(?), wir hören ihre schweigenden Schreie(?). Und für sie gilt es, ein Leben der Brüderlichkeit, der Gerechtigkeit, der Freiheit und Einheit aufzurichten mitten in einer grausamen, tyrannischen und ungerechten Zeit. Jetzt tut es not, dass die Gemeinde so wie noch niemals zusammensteht und in heiligster Begeisterung den Weg geht zum Reich Gottes und zu allen Menschen der Not und des unterdrückten Standes. Darum bitte ich alle, ohne Ausnahme!
Brüder, hört das Wort …
Benutzte Bücher:
Bauernkrieg: Mennon. Lexikon, Bd.1, A-F S. 137-139
R.G.G. I (A-D) S. 806-809
Zwölf Artikel: Gerdell, Die Revolunionierung der Kirchen
Balthasar Hubmaier: Menn. Encyclopia Vol.II D-H S. 826-834
Dr. Balthasar Hubmaier u.d. Anfänge der Wiedertaufe in Mähren – (EAHD 24) – Loserth
Hans Hut: Menn. Encyclopia Vol.II D-H S. 846
Reformation des Kaiser Sigismund: R.G.G.IV (Mi-R)
Reiser, Friedrich S. 1851